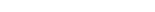Reportage: Paul Moore, Session-Bassist und Dozent

Zu seinen Referenzen auf Tour und/oder im Studio zählen Van Morrison, Mark Knopfler, Paul Brady, Katie Melua oder die Chieftains, dazu Musical-Produktionen und Filmmusik-Aufnahmen – keine Frage, der Bassist Paul Moore gehört zu den eingefleischten Szene-Profis in Irland, er unterrichtet zudem ein Studium am Dublin Institute of Technology. In Zeiten, in denen sich Profimusiker schimpft, wer ein Instrument und ein Recording-Interface besitzt, gilt noch immer – Erfahrung macht den Meister. Das weiß kaum einer besser als Moore: Er schöpft aus unzähligen Takes und erklärt den Unterschied zwischen Session-Theorie und -Praxis. Er beschreibt auch den Vorteil für Musiker, Lautstärke von Intensität zu unterscheiden und sich umfassend mit Spielpraxis auseinanderzusetzen, statt nur kurz auf YouTube „nachzudengeln“. Einblicke in den Alltag eines Session-Profis.
Von Nicolay Ketterer. Fotos: Nicolay Ketterer, Paul Moore
Paul Moore ist seit 28 Jahren Profi-Bassist, der 45jährige hat lange Jahre getourt, stand teilweise acht Mal die Woche auf der Bühne. Da sei kein Platz mehr für einen normalen Alltag. „Man ‚lebt‘ auf der Bühne. Das dreht einen durch den Wolf.“ Moore hat für Mark Knopfler eingespielt, für Van Morrison und andere – die Erfahrungen im Studio, was am Ende einen professionellen Musiker ausmacht, der im Studio unter Druck abliefern kann, will er auch anderen vermitteln. Moore unterrichtet am Dublin Institute of Technology einen E-Bass-Kurs, den er mit entworfen hat. „Mein Hauptziel war, dass nach vier Jahren, am Ende des Studiums, ein Student theoretisch in der Lage sein sollte, für mich einspringen zu können. Egal, ob Orchester-Auftrag, eine Filmmusik-Session oder Arbeit mit Songwritern.“
Wie er einen professionellen Bassisten definiert? „Man sollte viele Stile beherrschen, gleichzeitig aber seinen eigenen mitbringen. Oft wollen die Leute genau den hören – gerade, wenn man für neue Kompositionen einspielen soll.“ Die Inhalte im Studium? „Neben Theorie und -Praxis des Instruments auch das Musikgeschäft an sich, Live-Performance und Bühnenpräsenz – etwa schnell auf die Bühne zu gehen und schnell wieder runter, wie man mit Problemen umgeht.“ Wie sieht er das Thema Bühnenlautstärke und die Belastung, die über die Jahre entstehen kann? „Bei der Musik, mit der ich zu tun habe, ist Lautstärke zum Glück kein Thema.“ Vieles davon ist Songwriter-Musik, zu 50 Prozent akustische Besetzungen, und selbst mit E-Bass überschaubare Lautstärke. Gelegentlich spielt er auch härteren Rock, in einer Band in Dublin mit dem ehemaligen Thin-Lizzy-Drummer Brian Downey. „Du würdest vermuten, dass Brian lautes Spiel gewohnt ist. Aber der mag das auch nicht.“ Das sei besonders für seine Studenten wichtig: „Verwechselt nicht Intensität mit Lautstärke!“ Wie er den Unterschied beschreiben würde? „Viele Menschen schreiben Lautstärke guten Klang zu – ‚es ist lauter, also muss es gut sein‘. Für mich liegt der Schlüssel in bewusstem Hören: Man sollte in der Lage sein, in einer Band die einzelnen Elemente zu jedem Zeitpunkt zu hören; Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger - Hihat, Bassdrum und so weiter, jedes Element immer definiert wahrnehmen, sich selbst natürlich auch.“ Eine bewusste Übung, schließlich zeigt schon der „Lauheitskrieg“ bei CDs, dass eine lautere Aufnahme im ersten Moment mehr Aufmerksamkeit erregt und als scheinbar besser bewertet wird. „Viel Arbeit, die ich Dublin mache, besteht aus Bass, Drums, Gitarre und komplettem Orchester – Filmmusik-Aufnahmen oder Klassik. Wenn Du als Bassist neben einem Cellisten stehst – der hat keinen Verstärker, und möchte sich selbst auch noch hören! Darauf musst Du Rücksicht nehmen.“ Moore hat auch beim „Concerto for Group and Orchestra“ von Deep-Purple-Organist Jon Lord mitgespielt, in einer Besetzung aus Rock-Band und Orchester. „Dabei muss man sehr intensiv und kräftig spielen. Das kann man auch bei kleinen Lautstärken erreichen. Nur Jon Lord selbst spielte seine Hammond über zwei Leslie-Speaker, die angezerrt und dafür laut sein mussten. Aber sie standen draußen auf dem Parkplatz!“ lacht er.

Zurück zum Studienfach und angehenden Profi-Musikern: Beim Vermitteln verschiedener Stile ist ihm wichtig, die Studenten in einem behandelten Stil komponieren zu lassen, anstatt nur Noten nachzuspielen – damit tauche man nicht in die Musik ein. „Man ist nicht kreativ, man löst sozusagen kein Problem!“ Das sei es eigentlich, was einen professionellen Studiomusiker ausmache – Probleme lösen zu können. „Die Leute sagen bei einer Session ganz selten: ‚Das ist die Basslinie, spiel das so!‘ Außer man spielt in einer Cover-Band. Bei neuen Kompositionen bekommt man meist nur einen generellen Leitfaden: ‚Die Akkorde sind G, C und D.‘ Die Basslinie musst Du selbst finden. Impliziert wird: ‚Löse das Problem!‘ Und oft hat man vielleicht 60 Sekunden Zeit.“ lacht er. Deswegen werde man engagiert – wegen der Verlässlichkeit, ein planbares Ergebnis zu erreichen. „Was bei einer Session auch wichtig ist: Zu wissen, wann man nicht der richtige für den Job ist.“ Ihm sei das noch nicht passiert, aber das habe er von seinem Vater – ein Session-Gitarrist – gelernt: „Beim ersten Take spielt man instinktiv, was einem einfällt, danach hört man sich das Feedback des Produzenten oder Komponisten an und wechselt bei Bedarf das Instrument für einen anderen Klang. Man filtert die Rückmeldung, die man bekommt. Spätestens beim dritten oder vierten Durchgang geht es um die eigentliche Performance.“ Wenn er sich für fehl am Platz halten würde? „Dann kann man sagen: Ich glaube, ich bin nicht der richtige für den Job, aber ich empfehle Dir jemanden, der passt.“ Ob die Ehrlichkeit helfe? „Was dann passiert: Der Produzent rudert zurück und sagt: ‚Nein, es klingt großartig, alles in Ordnung!‘“ lacht er. „Du ziehst die Reißleine: Wenn Du es allen recht machen willst, kann das am Ende dem Ergebnis schaden. Oder wenn der Produzent versucht, Dir 70 Takes aus dem Kreuz zu leiern, was auch kein optimales Ergebnis liefert.“
Problematisch findet er, wenn Dritte im Studio – etwa der Tontechniker oder angeheuerte Musiker – ungefragt ihre Meinung äußern. Das sei unangenehm für Künstler, Session-Musiker und Produzent, wenn zu viele Leute Entscheidungsgewalt einfordern, die sie in ihrer „angeheuerten“ Situation nicht haben. Auf das Problem macht er seine Studenten aufmerksam: „Ihr solltet als Bassist selbstbewusst sein, aber nicht so selbstbewusst, dass ihr besser wisst, was der Künstler will als der selbst – ihr müsst flexibel bleiben. Sonst heißt es am Ende: ‚Der Musiker war ganz gut, aber ich habe nicht das Ergebnis bekommen, das ich wollte.‘“ Erfahrung spiele eine Rolle, die Vorstellungen von Künstlern richtig interpretieren zu können. „Ich denke, es ist in Ordnung, eine Meinung zu haben, allerdings erst, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat. Die Leute, die als erste ihre Meinung raushauen, sind oft die, die meistens ihre Klappe halten sollten.“ lacht er. Es gehe auch darum, keine vorgefertigte Idee zu haben, wie ein Song sein müsse, sondern sich vom Prozess leiten zu lassen.
Wie man Songs heute lernt? Wer anhand von YouTube-Showcases lerne, missverstehe, dass er zwar die Noten, nicht aber den dahinterstehenden Ausdruck lernt. „Warum sind die Künstler ursprünglich zu der Tonfolge gekommen? Welche Entscheidungsprozesse stecken dahinter?“ Sich in die Musik „einzufinden“ sei ein wichtiger Aspekt. „Bei manchen jungen Studenten fällt mir ein Missverständnis auf. Ich erinnere mich an einen Bewerber für den Kurs, den ich fragte, was er nach seinem Abschluss machen wolle. Er meinte nur: ‚In Stadien spielen, internationale Acts. Wenn das nicht klappt, kann ich am Ende immer noch Sessions spielen und unterrichten, so wie Du,‘“ lacht Moore. „Ich dachte mir: Irgendwas muss ich bisher falsch gemacht haben.“ Nicht nur bei den Schulen, sondern auch den Schülern entstünden mittlerweile hohe Erwartungen – teilweise ungerechtfertigt. „Heute kann man manchmal eine Bass-Einzelspur einer Aufnahme hören, man kann sich Transkriptionen besorgen oder einen Track verlangsamen, ohne dass sich die Tonhöhe ändert. Das sind unglaublich viele Quellen! Die Studenten haben mich mal gefragt, wie wir das früher gemacht haben.“ Er zeigt, wie er eine Plattennadel aufsetzt und nach den ersten Tönen wieder eine Rille zurücksetzt, immer wieder. „Dadurch muss man sich selbst ‚durcharbeiten‘, der Prozess war nachhaltiger und weniger unverbindlich, man kratzt nicht nur an der Oberfläche. Wenn man sich selbst damit beschäftigt, anstatt das Ergebnis serviert zu bekommen, saugt man das Wissen tiefergehender auf.“

Das erinnert an eine Aussage von Mark-Knopfler-Bassist Glenn Worf, Musik würde heute von Musikern mitunter nicht mehr gehört, sondern gesehen, und regionale Stile und Eigenheiten von Studio-Musikern – etwa der Motown-Stil – seien obsolet geworden, weil durch die „Globalisierung“ der Musik jeder Stil überall auf der Welt gecovert und die natürlich gewachsene Kultur entfallen würde. Moore meint, das sei ein guter Punkt. „Die ‚leben‘ es nicht, das ist wahr.“ Mit Worf hat er zusammen auf Knopflers erstem Solo-Album „Golden Heart“ gespielt. „Ein paar Songs wurden mit Musikern aus Nashville – darunter Glenn – dort aufgenommen, damit es nach einer ‚Nashville-Band‘ klang. Andere Songs in London, mit dortigen Musikern, und ein paar in Dublin, mit traditionellen irischen Musikern, mit mir als Bassist. Für Studenten gilt meiner Ansicht nach: Man kann den Abschluss machen und nach New York, London oder sonst wohin gehen – aber was dann? Das einzige, was die Dich von anderen unterscheidet, ist Deine musikalische Herkunft.“ Wie er den aktuellen Stand der Zunft sieht? „Ich glaube, der Begriff Session-Musiker wird missbraucht.“ lacht er. Den gab es in den 1950ern, 60ern, 70ern – heute kaum noch, auch, weil es keine klassische „Session“ mehr gibt, jeder zu Hause aufnimmt. Heute muss ein Profi-Musiker seine Tätigkeiten aufteilen. „Es gibt viele, die sich Session-Musiker nennen, aber nicht wirklich welche sind – Leute, die auf zwei, drei Platten gespielt haben, aber keine Recording-Dates machen oder viele verschiedenen Stile bedienen können.“ Gleichzeitig respektiert er Musiker, die eben nicht Session-„Allrounder“, sondern einfach nur für die eigene Band und den eigenen Stil zu professionalisieren. Was den klassischen Session-Bereich angeht: „Wenn es um aufwendige Filmmusik und große Produktionen geht, tauchen bei einer Session in Dublin immer wieder die gleichen wenigen Namen auf, eben aufgrund ihrer Erfahrung.“
Das Spiel selbst, in der kurzen Zeit einer Session sich auf die Musik einzulassen: Wie er sich der Aufgabe nähert, die passende Basslinie für reduzierte Songwriter-Musik zu finden? „Es geht darum, auf die Phrasierung des Sängers zu achten. Wenn Du stark rhythmische Phrasierungen unter den Gesang legst, kann das den Gesang stören. Man sollte wissen, wie die Lyrics phrasiert werden. Am Ende der Phrasierung kann man mit einer Basslinie weiterführen.“ Es gehe – einmal mehr – ums Zuhören. „Bei Singer/Songwriter geht es auch darum, die Bedeutung der Texte zu kennen – das wird bei Bassisten und Schlagzeugern am meisten unterschätzt. Außerdem sollte man die verschiedenen Teile – Strophe, Bridge, Refrain – so gestalten, dass sich der Song immer vorwärts bewegt, also den gesamten Song über etwas passiert.“
Kommentare
Kategorien
Anzeige
 5331
5331