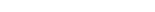Technik Abtastraten

Technik Abtastraten
Mit der Einführung der CD zu Beginn der 1980er Jahre begann gleichzeitig der Siegeszug der digitalen Signalverarbeitung in der Audiotechnik. Neben den unbestreitbaren Vorzügen der neuen Technik, die ihre schnelle Akzeptanz auf breiter Front erklären, gibt es aber gerade für die Übertragung von Musik dennoch entscheidende Nachteile: Dem Digitalstandard erster Generation (CD und Rundfunk-/Industriestandard mit 16Bit bzw. 24Bit/48kHz) fehlt die Übertragungsgenauigkeit, um ein Musiksignal sowohl in musikalisch-künstlerischer wie auch in klanglicher Hinsicht adäquat übertragen zu können. Mit DVD-Audio und SACD gab es zwei Versuche, diese Nachteile der „alten Digitaltechnik“ zu überwinden. Hauptsächlich aus marktpolitischen Gründen müssen diese Bestrebungen inzwischen aber als gescheitert angesehen werden. Durch die derzeitige Entwicklung hin zu nicht-physischem Musikvertrieb per Download übers Internet, dabei dank schneller Datennetze auch in hervorragender Masterqualität, und Abspielen per Netzwerk-/Mediaplayer erfahren hochauflösende Tonformate nun einen ganz neuen zeitgemäßen Verbreitungsweg und erfreuen sich somit stetig wachsender Akzeptanz. Die Defizite des CD-Formats und ähnlicher Technik sind vergleichsweise subtil im Gegensatz zu den zunächst so offensichtlichen Vorteilen und werden deshalb seither kontrovers diskutiert. Der folgende Artikel wird nun zunächst der Frage nachgehen, wie sich die Nachteile äußern und womit dies begründet werden kann. Im Zentrum der Betrachtungen sollen aber weniger irgendwelche abstrakten technischen Eigenschaften stehen, im Kern geht es stets um die Musik selbst. Die folgenden Betrachtungen werden dafür sensibilisieren und im Zuge dessen auch Erklärungen liefern, wie das CD-Format den künstlerischen Gehalt einer Aufzeichnung reduziert, die empfundene Intensität und Atmosphäre einer Darbietung beeinträchtigt, wie digitale Standardtechnik zu einer unglaublichen Nivellierung der vor dem Mikrofon dargebotenen Vorstellung der Interpreten beiträgt, und wie dadurch die Musikaufzeichnung im allgemeinen über die letzten 25 Jahre viel von ihrem besonderen Reiz und ihrer Faszination verloren hat. Das liefert dann gleichzeitig auch einen Erklärungsansatz, wieso Musikkonserven heute immer mehr nur noch als schlichter Konsumartikel à la „akustisches Fastfood“ gesehen werden, gleichzeitig aber auch so unglaublich viele Musikliebhaber der Vinyl-Schallplatte treu geblieben sind und auf ihre unerreichte Musikalität schwören. Letztlich wird gezeigt werden, dass erst hochauflösende Digitalformate die positiven Eigenschaften der Analogtechnik bezüglich einer musikalisch wie klanglich vollkommeneren Übertragung uneingeschränkt ins Digitalzeitalter retten und damit nun die Nachteile der Technik erster Generation überwunden werden.
Ralf Koschnicke von ACOUSENCE records
Meine alltägliche Erfahrung mit hochauflösender Digitaltechnik und ausgereifter Analogtechnik über mehr als zehn Jahre hat nämlich recht eindrucksvoll bewiesen, dass – nennen wir es mal – das Begeisterungspotential einer Musikaufnahme, neben selbstverständlich auch der künstlerischen Darbietung vor dem Mikrofon oder der Methodik bei der Aufnahme, deutlich von der technischen Qualität der Aufzeichnung und Übertragung bestimmt wird. Die Argumentation gründet dabei – um dies in aller Deutlichkeit gleich vornweg klar zu stellen – nicht auf einer rein theoretischen Ebene, und schon gar nicht gibt es irgendwelches „ideologisch geprägtes“ Interesse, eine bestimmte Technologie zu befördern oder bestimmten Lagern zu zuarbeiten. Ganz sicher geht es auch nicht um eine generelle Verteufelung der Digitaltechnik und ebenso wenig um eine Glorifizierung der Analogtechnik. Die folgenden Betrachtungen beziehen ihre Motivation voll und ganz aus den Beobachtungen aus der täglichen Praxis eines Tonschaffenden und gehen aus reinem Interesse an der Musik der Frage nach, wie wir ein möglichst großes Wirkpotential der Musik auch beim Hören von Tonaufnahmen erschließen können.
Und die Unterschiede waren auch hier stets signifikant. Trotz aller technischer Weiterentwicklung hat sich an der Beobachtung, dass in Abhängigkeit von der digitalen Audioqualität feinste Informationen verloren gehen, und dies in einer Größenordnung, wo neben sicherlich auch deutlich vorhandenen klanglichen Unterschieden aber insbesondere die Musik und ihre Wirkung auf den Hörer entscheidend beeinflusst wird, bis heute nichts geändert. Auch wenn in unserer Branche erstaunlich viel Energie darauf verwendet wird, immer wieder mal aufs Neue „wissenschaftlich“ zu beweisen, dass diese Beobachtungen nicht existent sein können, so gehört dieser Umstand bei mir seit vielen Jahren zum ganz normalen Alltagsgeschäft. Und dies zu thematisieren scheint mir so extrem wichtig, weil sich die klanglichen Unterschiede zwar unter Umständen in Abhängigkeit von der Abhöranlage recht schnell relativieren, die musikalischen Auswirkungen meiner Erfahrung nach aber selbst auf einfachsten Abhöranlagen stets gut spürbar bleiben. Gerade auch die Renaissance der LP hängt für mich eindeutig mit diesem Umstand zusammen, weil dort trotz aller vordergründig vorhandener Unzulänglichkeiten die musikalisch wirklich wichtigen Parameter besser übertragen werden. Aber auch die stetige Vorliebe vieler Musikliebhaber für Re-Issues alter Aufnahmen auf CD geht in die gleiche Richtung, denn auch wenn der Tonträger CD gewisse Einschränkungen innehat, so potenzieren sich die Probleme doch bei den meisten modernen Produktionen, bei denen mit digitaler Standardtechnik in allen Stufen der Produktion gearbeitet wird. Aufnahmen aus den 60ern und 70ern, bei denen „nur“ das Endmedium CD das Nadelöhr bildet, bereiten oft einfach noch vergleichsweise viel Vergnügen beim Hören.
Wie oben bereits angedeutet, wird im Zentrum der Betrachtungen die Zeitauflösung des Übertragungssystems stehen. Die Art und Weise, wie sich verschiedene Aufzeichnungsverfahren akustisch unterscheiden und die Beschaffenheit des zu übertragenden Signals Musik, legen die Vermutung nahe, insbesondere das Verhalten des Übertragungssystems im Zeitbereich für die beobachteten Phänomene verantwortlich zu machen. Um dies verstehen zu können, müssen wir zunächst aber den grundsätzlichen physikalischen Zusammenhang zwischen Übertragungsbandbreite im Frequenzbereich und Auflösungsvermögen im Zeitbereich verstehen. Eine anschauliche Verdeutlichung soll hier, ohne zu tief in die Mathematik einzusteigen, genügen: Fourier beschreibt mathematisch, dass jede periodische Signalform dargestellt werden kann als Überlagerung diskreter periodischer Sinusschwingungen. Das Ausgangssignal für unser Beispiel soll die positive Halbwelle einer Rechteckschwingung sein:
Aus drei einzelnen Sinusschwingungen (Partialschwingungen) zusammengesetzt, sieht das Signal dann wie folgt aus:
In der Summe sieht das Signal dann aus, wie in der unteren Abbildung auf dieser Seite gezeigt. Das Originalsignal setzt sich gemäß folgender Gleichung aus unendlich vielen Partialschwingungen zusammen:
Die obige auf drei Partialschwingungen reduzierte Darstellung wird beschrieben durch:
Drei wichtige Dinge lassen sich nun bereits anschaulich sehr leicht verstehen: 1. Es kann in einem Übertragungssystem kein Signal dargestellt werden, welches kürzer ist als die halbe Wellenlänge der im System maximal möglichen Schwingungsfrequenz.
2. Um dann bei entsprechend gegebener Strukturgröße noch einen Signalverlauf mit einer höheren Steilheit als beim Sinus abbilden zu können, benötigt man zusätzlich noch ungeradzahlige Vielfache der Grundfrequenz.
3. Der Beitrag dieser Partialschwingungen zum Gesamtsignal nimmt mit zunehmender Ordnung stark ab. An sich genügt diese Darstellung zum Verständnis der später folgenden Sachverhalte. Aber auch wenn man sich in Betrachtungen oft darauf stützt, so ist sie allerdings dennoch sehr vereinfacht. Denn genau so gilt das Gezeigte nur für periodische Signale. Für nichtperiodische Signale, was im Falle von Musik eigentlich immer zutrifft, muss eigentlich eine umfassendere Erklärung angewandt werden:
Ein ganz allgemein gültiges physikalisches Grundgesetz beschreibt nun den Zusammenhang zwischen Übertragungsbandbreite und zeitlichem Auflösungsvermögen (siehe Heisenbergsche Unschärferelation):
Wobei Δt die zeitliche Dauer des Impulses und Δf die Bandbreite der harmonischen Partialschwingungen bezeichnet, aus denen sich der Impuls zusammensetzt. Ohne näher auf die Theorie dahinter einzugehen, erkennt man dennoch auch hier wieder die Verknüpfung zwischen maximal zulässiger Frequenz und zeitlicher Ausdehnung. Da technisch real existierende Übertragungssysteme in ihrer Bandbreite immer begrenzt sind, sind sie somit auch nicht in der Lage, unbegrenzt feine zeitliche Strukturen aufzulösen. Ein realer Impuls besitzt immer eine bestimmte zeitliche Dauer, die unmittelbar mit der Bandbreite des Übertragungssystems korreliert. Je kleiner die Bandbreite, desto größer die zeitliche Ausdehnung des Impulses und umgekehrt. Und was hier exemplarisch für den Impuls gezeigt wurde, gilt so generell für jede Art von Signalstruktur:
Frequenzspektrum über die Zeit einer Orchesteraufnahme
Und Untersuchungen im Bereich Instrumentenakustik wiederum zeigen, dass der Mensch kleinste Signalstrukturen bis hinab zu einer Größenordnung von 5 µs wahrnimmt und diese für einen natürlichen Höreindruck benötigt. Erinnern wir uns an den oben kennengelernten Zusammenhang zwischen Frequenzbandbreite und rechnen nun die 20 Kilohertz der höchsten hörbaren Frequenz um in Zeitauflösung, so ergibt das 25 µs. Rechnet man die 10 ms Zeitauflösung für diskrete Ereignisse um in eine maximal hörbare Frequenz, so dürften wir keine Frequenzen über 50 Hz (das ist die Frequenz eines Netzbrummens) hören. Gleichzeitig hören wir beim Bestimmen von Richtungen Zeitabstände von 10 µs und nehmen in Klängen Signalstrukturen bis hinab zu 5 µs wahr. Alle Beispiele zusammengenommen zeigen nun eindeutig, dass der zuvor auf technischer Ebene dargelegte physikalische Zusammenhang von Bandbreite und Zeitauflösung so nicht auf den Menschen übertragen werden darf, weil unser „psychoakustischer Filter“ immer mit beteiligt ist. Der menschliche Hörbereich, die Präzision in der Richtungswahrnehmung, die Empfindlichkeit bei der Bewertung von Klängen und das an sich sehr begrenzte Selektionsvermögen bezüglich zeitdiskreter Ereignisse würden sonst in starkem Widerspruch zueinander stehen. Es ist außerdem davon auszugehen, dass die hohe Zeitauflösung beider Ohren im Zusammenspiel nicht nur zur Richtungsbestimmung benutzt wird, sondern unserem Hörsystem insgesamt die Fähigkeit gibt, Klangstrukturen sehr genau auszuwerten.
Orchesteraufnahme einer SACD, der weiße Bereich beschreibt das Quantisierungsrauschen
Kommentare
Kategorien
Anzeige
 2939
2939